Hier geht´s zum Original Artikel:
http://www.christundwelt.de/detail/artikel/bens-botschaft/

Bens Botschaft
Aus: Christ & Welt Ausgabe 04/2014
Ein Junge kommt mit einer tödlichen Krankheit zur Welt, die Ärzte geben ihm kein Jahr. Die Eltern sehen, wie ihr Sohn sich quält, und bemühen sich um Sterbehilfe. Die wird verweigert. Nun, im Rückblick, sind sie dankbar, dass ihr Wunsch nicht erfüllt wurde. Denn: Wer bestimmt, wann der Tod eine Erlösung ist?
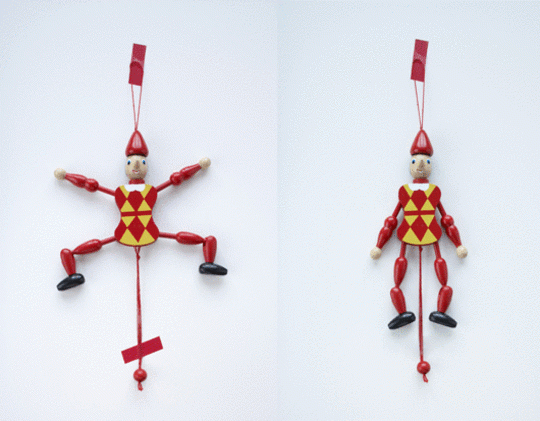
Foto: Elektrons 08/plainpicture
Ganz zum Schluss hat Daniela Schneider ihren Sohn nur noch festgehalten. Hat ihn gestreichelt, geküsst und ihm gesagt, dass sie ihn niemals vergessen wird. „Ich habe ihm erzählt, dass ein Engel kommen und ihn abholen wird. Und dass er dort, wo er hingeht, keine Schmerzen mehr haben wird. Dass sein Kampf dann zu Ende ist.“
Zu diesem Zeitpunkt haben Ben und seine Eltern eine Odyssee hinter sich. Schnell nach der Geburt des kleinen Jungen im Juni 2008 wird klar, dass Ben nicht ist wie andere Kinder. Er ist zu schwach zum Trinken, schläft kaum, weint viel. Ein Ultraschall bringt das Unfassbare ans Licht: Ben hat einen Balkenmangel, der Bereich in seinem Gehirn, der die beiden Großhirnhälften miteinander verbinden soll, ist nicht richtig entwickelt. Was diese Fehlbildung für ihren Sohn bedeuten wird, kann Daniela Schneider zu diesem Zeitpunkt niemand sagen: Eine schwerste Behinderung, bei der Ben niemals laufen oder sprechen lernen wird, ist ebenso möglich wie eine normale Entwicklung.
Doch die gibt es für die Schneiders nicht. Mit einem halben Jahr bekommt Ben Krampfanfälle, immer wieder sackt die Sauerstoffsättigung in seinem Blut ab. Am 13.Februar 2009, Ben ist noch nicht acht Monate alt, fällt in einem Gespräch mit den Ärzten der Satz, den Daniela Schneider niemals vergessen wird: „Ihr Sohn wird sein erstes Lebensjahr nicht erreichen.“ Die Diagnose lautet Morbus Alexander; eine sehr seltene, genetisch bedingte Stoffwechselstörung, die unaufhaltsam die weiße Substanz in Bens Gehirn und Rückenmark zerstört. Eine Heilung ist nicht möglich.
„An dem Tag haben wir es noch nicht geglaubt“, erinnert sich Daniela Schneider, „aber uns wurde schnell klar, dass die Ärzte wohl recht hatten. Ben krampfte unentwegt, er musste sediert werden, um überhaupt aus dem Krampf herauszukommen. Er machte die Augen nicht mehr auf und musste künstlich ernährt werden.“ Damals sei ihr das erste Mal der Gedanke gekommen, es sei vielleicht leichter, Ben von diesem Dasein zu erlösen. Kann nicht irgendjemand Bens Leid verkürzen?
Auf Nachfragen versichern ihr Ärzte und Schwestern, ihr Sohn werde palliativ betreut. Dabei geht es nicht mehr um Heilung, sondern darum, die Symptome der Krankheit zu lindern. Man sagt Daniela Schneider, man werde alles nur Mögliche dafür tun, dass Ben nicht leiden werde. „Aber er hatte Schmerzen. Er hat gelitten. Da bin ich mir absolut sicher. Es gab Zeiten, da hat er nächtelang geschrien, das macht kein Baby einfach so. Es hat immer sehr lange gedauert, bis die richtige Medikation gefunden wurde. Dann war er ruhiger, und ich konnte in seinen Augen sehen, ob er leidet oder nicht. In seinen letzten Monaten konnte Ben nicht mehr weinen. Aber ich habe immer gewusst, wann es ihm gut ging und wann nicht.“
Daniela Schneider hat für ihren Sohn eine Homepage eingerichtet. Jeden seiner wenigen Lebensmonate hat sie darauf nachgezeichnet. Wer die Bilder von Ben sieht, der sieht ein Baby sterben. Ben verlischt im Frühjahr und Sommer 2009. Seine einst so strahlenden Augen leuchten nicht mehr, er kann nicht mehr lächeln. Immer wieder geht es dem kleinen Jungen so schlecht, dass Daniela Schneider glaubt, sie bringe ihr Kind zum letzten Mal zu Bett. Jeden Abend legt sie sich gemeinsam mit ihm schlafen und rechnet nicht damit, dass Ben, der inzwischen Morphium bekommt, wieder wach wird.
„Aber er hat immer wieder gekämpft. Wir haben seinen Geburtstag gefeiert, und meine Eltern haben uns noch besucht.“ Dann kommt der Tag, an dem Daniela Schneider spürt, dass alles anders ist. „Ben hat nicht mehr gekämpft“, sagt sie, „er hat sich auf den Weg gemacht.“ Am 8.Juli 2009 um 13.30 Uhr holt Ben zum letzten Mal Luft. Er sieht zufrieden aus. Sein Herz hört auf zu schlagen. Ben ist tot.
Für Daniela Schneider endet an diesem Tag ein Kampf, den zu führen sie sich nie vorstellen konnte. Wäre es nach ihr und ihrem Mann gegangen, hätte Bens Sterben schon kurz nach der Diagnose ein Ende gefunden. „Als Ben im Februar auf der Intensivstation lag, wollten wir unbedingt Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Wir mussten mit ansehen, wie er stundenlang krampfte, wie ihm Blut aus Nase und Ohren lief. Wir haben miterlebt, wie unser Kind, das mit drei Monaten sein Köpfchen halten konnte, jeden Tag mehr und mehr abgebaut hat.“ Familie Schneider will mit Ben ins Ausland fahren, um seinem Leiden dort ein Ende zu setzen – und scheitert an den bürokratischen Vorgaben.
Wäre Ben in den Niederlanden zur Welt gekommen, wäre er vielleicht viel früher gestorben. Dort ist es möglich, schwerstkranken Kindern das Sterben zu erleichtern. Seit vielen Jahren wird diese Form der Sterbehilfe praktiziert, das „Groningen-Protokoll für neonatale Euthanasie“ formulierte 2005 Kriterien, nach denen Ärzte das Leben von Kindern aktiv beenden können. Im Sommer 2013 hat die Königliche Ärztevereinigung der Niederlande den Bericht „Medizinische Entscheidungen bezüglich des Lebensendes von Neugeborenen mit sehr schweren Anomalien“ vorgelegt, der das Vorgehen legalisiert. Damit dürfen niederländische Ärzte straffrei Medikamente verabreichen, die innerhalb weniger Minuten zum Tod führen – bei Kindern mit geringer Lebenserwartung, deren Weiterbehandlung durch die Ärzte als „chancenlos“ eingeschätzt wird.
Der Kinderarzt und Rechtsmediziner Eduard Verhagen praktiziert diese Form der Sterbehilfe seit Jahren. Bei Babys, die mit Fehlbildungen zur Welt kommen, die schlimmste Schmerzen verursachen oder unzählige Operationen erfordern würden; etwa bei Epidermolysis bullosa, einer extrem schmerzhaften Hauterkrankung, oder mit Spina bifida, dem offenen Rücken.
Verhagen sagt, das Vorgehen der Niederländer sei ehrlich. Auf der ganzen Welt würden Ärzte handeln wie sie, nur zugeben würde das kaum jemand. Jeder Fall muss einer Kommission gemeldet werden; die Sterbehilfe kommt nur infrage, wenn die Prognose der Kinder aussichtslos ist, sie leiden und ihre Eltern zustimmen.
Auch in Belgien wird die Sterbehilfe bei Kindern in diesen Tagen diskutiert. Erst vor wenigen Wochen stimmte das belgische Oberhaus einem Gesetzentwurf zu, nach dem unheilbar kranke Minderjährige auf ihren Wunsch hin ärztlich getötet werden können. Im kommenden Mai wird das Parlament darüber endgültig entscheiden. Vertreter fast aller Parteien stimmen dem Entwurf zu. Der besagt, dass die Minderjährigen in der Lage sein müssen, die Folgen ihrer Entscheidung abschätzen zu können. Weiß ein Zehnjähriger, was der Tod ist? Kann eine 16-Jährige mit Klarheit sagen, dass ihr Leben keinen Tag länger dauern soll?
Für den Senatsabgeordneten Jean-Jacques De Gucht, der das Gesetz eingebracht hat, erlaubt dies den Kindern, zwischen Sterbehilfe und der Verlängerung ihrer Lebenszeit durch Palliativmedizin zu entscheiden. Vor zwölf Jahren, als das katholische Belgien die Sterbehilfe für Erwachsene erlaubte, tobte im Land ein heftiger Streit. Heute befürwortet eine Mehrheit der Bevölkerung eine Ausweitung. Auch viele Kinderärzte denken so. 16 von ihnen haben in einem offenen Brief geschrieben, junge Kranke seien „manchmal fähiger als gesunde Erwachsene, über das Leben nachzudenken und sich zu äußern“.
Anders als in Deutschland dürfen in Belgien Ärzte aktiv eingreifen, um das Leben ihrer Patienten zu beenden – etwa indem sie Medikamente verabreichen. Hierzulande steht das unter Strafe, Ärzte können aber auf eine Weiterbehandlung verzichten. Das geschieht auch immer wieder. Bei Neugeborenen, die durch eine extreme Frühgeburt oder schwerste angeborene Erkrankungen keinerlei Aussichten auf ein längeres Überleben hätten, gebe es immer zwei Optionen, sagt Andreas Schulze, leitender Neonatologe der Münchner Uniklinik in Großhadern: „Man kann eine Intensivtherapie durchführen oder den natürlichen Verlauf einer solchen Erkrankung respektieren. Künstlich lebensverlängernde Maßnahmen wie eine Beatmung werden dann nicht fortgesetzt.“ Werde das Therapieziel so verändert, dass nicht mehr das Überleben, sondern ein Sterben in Würde im Mittelpunkt der Behandlung stehe, sorge man dafür, dass die Kinder nicht unter Schmerzen, Atemnot oder anderen unangenehmen Empfindungen leiden müssten. Dass bestimmte Maßnahmen, etwa das Verabreichen von Schmerzmitteln, unter Umständen auch lebensverkürzend wirken könnten, nehme man dann billigend in Kauf.
Für Schulze und die meisten seiner deutschen Kollegen ist es ausgeschlossen, aktiv dafür zu sorgen, dass ihre Patienten sterben. Die Diskussionen in den Nachbarländern verfolgen sie dennoch interessiert. Christoph Bührer, Chef der Neo?natologie an der Berliner Charité, etwa sagt, die niederländischen Kollegen setzten sich mit der Problematik auseinander und suchten nach praktikablen Lösungen. „Und das ist gut so. In anderen Ländern ist man weniger mutig und lässt dadurch unter Umständen Patienten unnötig leiden. Letztlich muss man sich an der Würde als dem obersten Rechtsgut orientieren.“
Würde und Leid: Wie lässt sich das aufwiegen? Ist ein schneller Tod würdevoller als ein langsamer? Und wer entscheidet über die Würde von Patienten, die sich aufgrund ihres Alters noch gar nicht dazu äußern können, was sie ertragen können und wollen? Ist es denkbar, dass es für ein Kind besser ist, zu sterben als zu leben?
Der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio hat dazu eine entschiedene Position. Die Frage zu bejahen sei inakzeptabel: „Es ist doch eindeutig, dass dem Wunsch eines Minderjährigen nach der Todesspritze nie entsprochen werden darf. Wenn ein Kind oder Jugendlicher uns sagt, er wolle nicht mehr sein, dann können wir das nicht hinnehmen, sondern müssen ihn fragen, was ihn plagt, und dafür sorgen, dass es ihm besser geht. Man kann ihnen nicht darin zustimmen, dass ihr Leben sinnlos sei, man muss ihnen unsere Solidarität bekunden. Signalisieren, dass man alles für ihr Wohl tun wird.“
Wohl jeder Mediziner, der mit schwerkranken und sterbenden Menschen zu tun hat, wird im Lauf seines Berufslebens um Erlösung angefleht. Boris Zernikow beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Palliativmedizin, er hat den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin an der Universität Witten-Herdecke inne – und sagt, kein einziger seiner Patienten habe bislang wirklich sterben wollen. Gerade hat er einen 15-Jährigen behandelt, dem ein Knochentumor und Metastasen in kurzen Abständen unerträgliche Attacken von Vernichtungsschmerz verursachten. Zernikow und sein Team haben ihn mit einem Medikamentencocktail behandelt, der diesen Schmerz kontrolliert.
„Natürlich hat der uns vorher gesagt, dass sei alles Scheiße, er wolle das nicht mehr. Der will diesen Zustand nicht mehr, aber der will nicht sterben. Der Junge ist 15, hat eine Freundin. Der ist froh über jeden Tag, den er hat.“ Die Argumentation seiner belgischen Kollegen, es gehe darum, Kinder zu erlösen, denen sonst nicht geholfen werden könne, kann er nicht nachvollziehen. „Das ist Schwachsinn. Wir haben Möglichkeiten, die Symptome zu lindern oder jemand sogar zeitweise in einen kurzen Schlaf zu versetzen, in dem er keine Schmerzen spürt, aber aus dem er auch wieder aufwacht. Dafür braucht es Expertise und Personal, das sich mit einer guten Palliativmedizin auskennt. Was wir nicht brauchen, sind Medikamente, um Kinder zu Tode zu spritzen.“
Daniela Schneider ist heute froh über jede Sekunde, die sie mit Ben verbringen konnte. Bens Leben sei kurz, sein Sterben schlimm gewesen. „Aber es hatte einen Sinn. Es gibt immer noch Tage, an denen es mir schwerfällt, das zu sagen. Aber ich bin davon überzeugt. Ben hat uns gezeigt, was wirklich wichtig im Leben ist.“
Vielleicht wäre ihnen allen viel Kummer erspart geblieben, wenn sich ein Arzt gefunden hätte, der Ben geholfen hätte, früher zu sterben. „Aber dann hätten wir auch die Momente nicht gehabt, in denen wir uns so unglaublich nah waren.“ Noch immer muss Daniela Schneider weinen, wenn sie an Ben denkt und über ihn spricht. Aber nach mehr als vier Jahren verblassen die schlimmen Erinnerungen zugunsten der guten Momente. „Da war so viel Liebe, dass es für ein ganzes Leben reicht.“

An Ben erinnert die Homepage www.ben-sternenkind.de.
Auch dieses Bild gehört zum öffentlichen Fotoalbum.
Erschienen in:
Redakteur:
Susanne Kailitz
Erschienen am 16.01.2014